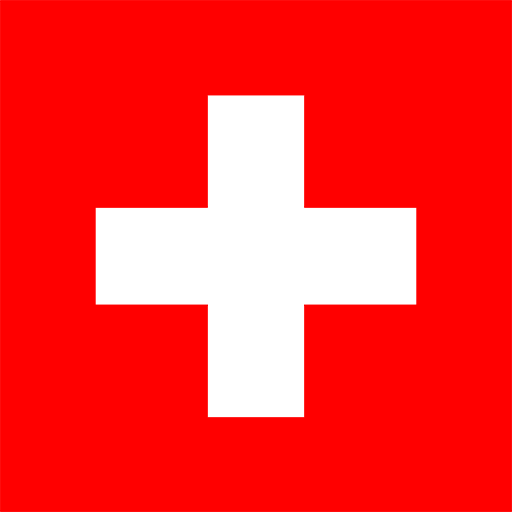Sich nicht einmischen. Still sitzen. Abwarten, gleichzeitig achtsam sein. Gute Dienste erledigen ganz ohne Rampenlicht. Diese Werte der Schweiz sind weltweit geschätzt. Sie sind historisch gewachsen und nützlich für alle Seiten. Mehr denn je.
Entstehung, Zusammenhänge, Bedeutung und Chancen – ein Essay von Christoph Mörgeli, Historiker.
Lebenswirklichkeit: schlau sein – ganz legitim
Es besteht kein Zweifel: Die Schweiz hat seit bald einem halben Jahrtausend eine erstaunliche Fähigkeit entwickelt, im Schatten rivalisierender Grossmächte eine Nische für ihr nationales Dasein zu finden. Die Neutralität unseres Kleinstaates hat sehr wenig mit Ideologie oder mit Idealismus zu tun, aber sehr viel mit der Lebenswirklichkeit.
Wenn sich mein grösserer Bruder auf dem Pausenplatz mit einem Gleichaltrigen prügelte, habe ich mich als kleinerer Bub mit geringeren Körperkräften zu meinem Vorteil von diesen Auseinandersetzungen ferngehalten. Ich hätte mir im Falle einer Einmischung im besten Fall eine blutige Nase geholt.
Ungeachtet meiner persönlichen Kindheitserlebnisse erfreut sich die schweizerische Neutralität gegenwärtig bei den sogenannt führenden Kreisen von Politik, Militär und Medien keiner grossen Wertschätzung; vom praktischen Realitätssinn des abseits stehenden kleinen Knaben auf dem Pausenplatz wollen sie nichts mehr wissen.
Die Lebenswirklichkeit scheint schwer aufzukommen gegen laut ausgestossene Parolen von internationaler Solidarität, gerechtem Krieg und kollektiver Sicherheit. Die Neutralität wird nicht mehr ertragen als das, was sie für viele Generationen von Schweizern war: die legitime Schlauheit, mit welcher der machtlose Kleinstaat neben den Grossmächten überleben wollte.
Diese Neutralität ist äusserst anspruchsvoll; sie verlangt von denen, die sie handhaben sollten, ein gehöriges Mass an Kreativität und Intelligenz, an Erfindungsreichtum und Grundsatztreue.
Liegt hier vielleicht der Grund, dass sich so manche der führenden Persönlichkeiten derart schwer mit der Neutralität tun?
Historisch bewährtes Erfolgsmodell
Die gegenwärtigen Neutralitätsnöte sind umso erstaunlicher, als niemand angesichts der historischen Erfahrung ernstlich bestreiten wird, dass es sich bei der schweizerischen Neutralität um ein Erfolgsmodell handelt. Der Bund der Eidgenossen hätte die ersten Anfänge kaum überstanden, wenn die Orte nicht ein gegenseitiges «Stillesitzen» und Vermitteln im Krisenfall beschlossen hätten. Später hätte unser konfessionell, ethnisch und kulturell gespaltenes Land ohne Neutralität angesichts von Religionskriegen und Zusammenschlüssen unserer Nachbarländer zu grossen Nationalstaaten nicht überleben können.
Es verwundert uns kaum, dass heute gewisse Historiker den Neutralitätsmüden bereitwillig zu Hilfe eilen. Der Schweizer Neutralitätsgedanke – so behaupten sie flink – sei im Wesentlichen ein Mythos und ein Konstrukt, aus Gründen der Staatsräson und der nachträglichen Rechtfertigung erst im ausgehenden 19. Jahrhundert entwickelt. Sie verweisen etwa auf die «Geschichte der Schweizerischen Neutralität» von Paul Schweizer aus dem Jahre 1895, ein Werk, das später Edgar Bonjour zu seinen weiteren vertiefenden Studien angeregt hat. Nur wird vergessen, dass sich Paul Schweizer keineswegs als kühn entwerfender Staatsideologe verstand; der frühere Staatsarchivar blieb auch als Geschichtsprofessor ein akribisch arbeitender, exakter Urkundenforscher. Aus den Schriftquellen des 15. Jahrhunderts vermochte er ohne Weiteres nachzuweisen, dass sich die Mitglieder des eidgenössischen Bundes schon damals im Falle von Konflikten zwischen den Orten zur Nichteinmischung verpflichtet hatten. Die Niederlage von Marignano bewirkte 1515 den Zusammenbruch der europäischen Machtpolitik der Eidgenossen. Dank der Staatsmaxime Neutralität blieb die Schweiz vom dreissigjährigen Religionskrieg und von den nachfolgenden europäischen Erbfolgekriegen verschont. Bereits 1638 wurde fremden Heeren jeder Durchmarsch versagt, was bis dahin übrigens nicht als neutralitätswidrig gegolten hatte. Die Eidgenossenschaft bekräftigte ihre Neutralitätspolitik mit einem gemeinsam geleisteten und bezahlten Grenzschutz – der sogenannten Defensionale – und einer Art Vormauernsystem durch neutralisierte Gebiete und Städte.
Die erste offizielle Neutralitätserklärung der Tagsatzung stammt vom 28. März 1674. Nach der Französischen Revolution und im Strudel der Napoleonischen Kriege geriet die Schweiz in die schlimmste Neutralitätskrise ihrer bisherigen Geschichte. Die Franzosen wie die gegen sie verbündeten Alliierten machten das Land zum Kriegsschauplatz und zur Besatzungszone. Interessanterweise ging die schweizerische Neutralität aus dieser Krise gestärkt hervor: Am 20. November 1815 erreichte die Schweiz erstmals die völkerrechtliche Anerkennung ihrer Neutralität. 1907 wurde das noch heute gültige Neutralitätsrecht auf der Haager Konferenz von 1907 in zufriedenstellender Weise völkerrechtlich kodifiziert. In den beiden Weltkriegen erreichte die neutrale Schweiz, dass die Kriegführenden ihre Grenzen respektierten – freilich nicht ohne grosse entsprechende Wehranstrengungen, die für den Staat wie für seine Bürger eine enorme Belastung darstellten.
Spezielle Aspekte unserer Neutralität
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Neutralität in den ersten drei Jahrhunderten vor allem im Dienste der Innenpolitik stand, in den letzten zwei Jahrhunderten dagegen im Dienste der Aussenpolitik. Die Schweiz hat die Neutralität nicht erfunden, ihr aber in verschiedener Hinsicht ein ganz eigenes Gepräge gegeben. Ihr Neutralitätsstatus unterscheidet sich grundlegend von dem anderer Staaten. Die schweizerische Neutralität ist dauernd; seit 1815 ist staatsrechtlich von der «neutralité perpétuelle» die Rede. Die Tradition der schweizerischen Neutralität kann ihre Wirkung bei den Nationen nur behalten, wenn sie ununterbrochen fortwirkt und bei jedem sich bietenden Anlass neu und unversehrt in Erscheinung tritt. Die schweizerische Neutralität ist bündnisfrei; weder ein Defensiv- noch ein Offensivbündnis mit anderen Staaten ist ihr gestattet. Im Weiteren ist die schweizerische Neutralität bewaffnet. Unser Land hat sich also zur militärischen Verteidigung verpflichtet und muss jederzeit garantieren, dass keine Gewalt von ihrem Hoheitgebiet ausgeht. Die schweizerische Neutralität ist frei gewählt und nicht das Ergebnis eines Diktates fremder Mächte. In der Pariser Akte von 1815 wurde vielmehr eine jahrhundertelange Praxis auf schweizerisches Begehren hin neu bestätigt. Und schliesslich war die schweizerische Neutralität zumindest bis vor Kurzem integral, also vollständig. In der Zwischenkriegszeit hat unser Land mit dem Beitritt zum Völkerbund vorübergehend an wirtschaftlichen Sanktionen der Völkergemeinschaft teilgenommen. Im 20. Jahrhundert galt aber im Allgemeinen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Krisenregionen der Grundsatz des «Courant normal», also das Beibehalten des Handelsumfangs auf dem Stand der Vorjahre. Im Golfkrieg von 1991 wurden militärische Überflüge fremder Mächte geduldet. Anfangs der 1990er- Jahre beteiligte sich die Schweiz erstmals an internationalen Wirtschaftssanktionen – damals gegen den Irak. Auch der UNO-Beitritt verpflichtet uns leider inzwischen zu entsprechenden Massnahmen. Seltsamerweise ist die in letzter Zeit üblich gewordene Teilnahme an Wirtschaftssanktionen hierzulande wenig hinterfragt worden. Ist das Aushungern eines Volkes eigentlich ein menschlicheres Gewaltmittel als der Waffeneinsatz? Warum muten wir eigentlich den von Hungerkrieg und Arbeitsplatzverlust betroffenen Mitmenschen zu, die Schweiz im Falle ihres Mitmachens noch als neutral zu beurteilen?
Zweifellos ist die Schweiz heute völkerrechtlich nach wie vor zur Neutralität ermächtigt und gleichzeitig auch verpflichtet. Die Neutralität ist kein Mythos, sondern gültiges Verfassungsrecht: Artikel 173 der aktuellen Bundesverfassung überträgt der Bundesversammlung als Erstes die Aufgabe, «Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz zu treffen». Artikel 185 überträgt dem Bundesrat genau dieselbe Pflicht. Bundesräte oder eidgenössische Parlamentarier, die gegen die Neutralität verstossen, brechen demnach ihren Eid oder ihr Gelübde. Denn sie verpflichten sich bei ihrem Amtsantritt, die Verfassung des Bundes «treu und wahr zu halten». Ein Neutralitätsverzicht würde zweifellos eine obligatorische Volksabstimmung voraussetzen. Höchst beunruhigend und wenig vertrauensbildend sind demnach alle Versuche, neutralitätsrechtliche oder neutralitätspolitische Grundsätze unter Umgehung des Volkswillens über Bord zu werfen.
Neutralität ist Friedenspolitik
Alle aktuellen Umfragen beweisen es: Gegen 90 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer beurteilen unsere Neutralität positiv und empfinden sie als ausgesprochen identitätsstiftend für unser Land. Dennoch leiden zahlreiche führende Persönlichkeiten in Politik, Kultur, Medien und Gesellschaft an der Schicksalslosigkeit unseres neutralen Kleinstaates. Sie sehnen sich nach einer «Sendung», nach Visionen und spektakulären Taten. Gewiss, die Neutralität schränkt den Handlungsspielraum und die aussenpolitischen Aktivitäten unserer Regierung in einer für sie ärgerlichen, sogar schmerzhaften Weise ein. Die Neutralität gewährt ihnen kaum Heldentaten und selten glanzvolle internationale Auftritte. Aber sie gibt der Nation auch keinen Raum für rauschhaften Siegestaumel oder für die Faszination des Krieges, die wir rational nicht erklären können, aber immer wieder als Tatsache feststellen müssen. Die Neutralität bewahrt uns vor der Hingabe an unkontrollierte Emotionen, vor unüberlegter Kriegslust und vor dem Nichternstnehmen von Grausamkeit und Gewalt.
Die Neutralität ist aber mehr als nur die Nichtteilnahme an Konflikten. Sie bedeutet den freiwilligen Verzicht auf äussere Machtpolitik. So gesehen hat die schweizerische Neutralität durchaus den positiven Gehalt einer grundsätzlichen Friedenspolitik. Die Schweiz wendet jenes Friedensprinzip, auf dem sie selbst beruht, auch auf das Verhältnis zu andern Staaten und Völkern an. Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen und Staaten von Natur aus gewaltbereit und kriegerisch sind, macht jeder Staat, der sich aus Kämpfen heraushält, unsere Welt ein Stück friedlicher. Die Neutralität bildet auch eine bessere Grundlage gegenüber der Bedrohung des weltweiten Terrorismus als die Parteinahme. Denn wer sich in einen Konflikt hineinziehen lässt, wird auch Zielscheibe. Unsere Neutralität schädigt niemanden. Wer versucht, unsere Neutralität zugunsten einer europäischen oder globalen Scheinsolidarität zu opfern und uns in einen Krieg hineinzuziehen, handelt keineswegs moralisch.
Wir erkennen in der herkömmlichen schweizerischen Neutralität zumindest eine fünffache Funktion: Sie wirkt innenpolitisch integrierend, bewahrt uns aussenpolitisch die Unabhängigkeit, garantiert wirtschaftlich den globalen Freihandel, leistet einen Beitrag ans europäische Gleichgewicht und übt wichtige Dienstleistungsfunktionen aus. Zweifellos ist die Bedeutung der Neutralität vor allem im letzten Bereich stark angestiegen. Die Leistung «Guter Dienste» ist zwar keineswegs das Privileg des Neutralen. Die Leistungsempfänger bringen aber erfahrungsgemäss dem unparteiischen, machtlosen Neutralen mit seiner langen Dienstleistungserfahrung ein besonderes Vertrauen entgegen. Umgekehrt hat auch der Neutrale ein Interesse, sein Abseitsstehen in den Konflikten dieser Welt nicht als Drückebergerei oder Schwarzfahrerei erscheinen zu lassen und so seine neutralitätsbedingte Zurückhaltung auszugleichen: Die Asylgewährung an echte Flüchtlinge, das Rote Kreuz, die Katastrophenhilfe, die Wahrnehmung von Schutzmachtmandaten oder der Sitz internationaler Organisationen dürften nach sachlichen Kriterien den Vorwurf des Nationalegoismus für die Schweiz entkräften. Es wäre aber heuchlerisch, wenn wir unsere Neutralität als ausschliesslich menschenfreundlich und selbstlos idealisieren würden. Das nationale Interesse darf sich durchaus mit dem internationalen verbinden. Gerade in den letzten Jahren haben unsere politischen Verantwortungsträger die Wahrung der Interessen von uns Schweizerinnen und Schweizern immer weniger zur Richtschnur ihres Handelns gemacht. Sie haben in der Regel zuerst gefragt, was die andern von uns erwarten, statt sich zuerst einmal darüber klar zu werden, was wir wollen.
Armee als Instrument des Widerstandes
Die neutrale Schweiz war seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr kriegerisch, aber sie blieb einsatzbereit. Das Wehrwesen des bewaffnet neutralen Kleinstaates unterscheidet sich grundlegend von dem anderer Länder. In grossen, obrigkeitsgeprägten Staaten verkörpert das Militär die Macht; der Krieg ist für sie die letzte Möglichkeit der Politik. Wenn es anders nicht geht, holen sie sich ihr Recht mit Gewalt. Der Impuls aber, der in der Schweiz seit Jahrhunderten das Wehrwesen belebt, ist nicht der Wille zur Macht, sondern der Wille, der Macht zu widerstehen. Unsere Wehrhaftigkeit wird bis heute verstanden allein aus dem Gedanken des Widerstandes. Dies scheinen jene Verantwortlichen des Verteidigungsdepartements zu vergessen, die jetzt neue Visionen bewaffneter Auslandseinsätze entwerfen. Die neutralitätsfeindlichen Stimmen von Politikern, Diplomaten und hohen Militärs mehren sich. Ein Schweizer Botschafter forderte in einer Rede in Deutschland, man solle unsere Neutralität «sanft einschlafen lassen». Offiziell geäusserte Sprüche wie «Heute wird der Friede im Ausland gesichert» bleiben nicht ohne verheerende Auswirkungen. Wie soll der militärische Kommandant angesichts solcher Parolen oberster VBS-Stellen seine Soldaten noch zum gewöhnlichen Wiederholungskurs im Inland motivieren? Gleiches gilt für die unüberlegte Aussage, die Armee gehe ohne Auslandeinsätze «vor die Hunde». Hier dürfte die militärische Führung einem geradezu tragischen Irrtum erliegen und das Gegenteil des Gewollten erreichen: Die Bewaffnung professioneller Einsatztruppen für das Ausland, die Zugehörigkeit zu einem Bund der Grossen, eine neuzeitliche «Heilige Allianz» der Gerechten wäre zweifellos ein bequemes Ruhekissen für all jene unter den Armeeangehörigen und Arbeitgebern, die nur darauf warten, die Last der Wehrpflicht von sich zu werfen. Der Abschluss von entsprechenden politischen oder militärischen Bündnissen würde gewiss zum wichtigen Hebel des Antimilitarismus. Müssen wir uns wundern, wenn dieselben Leute, die noch vor Kurzem den Krieg durch die Abschaffung unserer Armee unmöglich zu machen glaubten, heute dem bewaffneten Auslandeinsatz das Wort reden?
Neutralität als Garantin der Meinungsfreiheit
Unsere Neutralität ist nicht Selbstzweck oder blosse Gewohnheit, sondern sie sichert uns die Unabhängigkeit, und zwar neben der politischen vor allem die geistige und moralische Freiheit des selbständigen Urteils – sie ist also das Gegenteil von Abseitsstehen. Unser Staat ist keine Institution der Moral, sondern der Rechtsschöpfung und Rechtswahrung. Er ist ein reiner Zweckverband und unter keinen Umständen ein moralischer Vormund, weder der Bürger noch der Völkergemeinschaft. Ideale zu bilden und zu verwirklichen ist Sache der Menschen, der Familien, der Kirchen, der Vereine, aber niemals des Staates. Die politische Neutralität hat nicht zuletzt den Sinn, die Unabhängigkeit unseres Urteils zu gewährleisten. Der Staat hat nicht das Recht, uns Bürger auf eine bestimmte moralische Linie festzulegen. Die immer häufigeren moralisierenden Stellungnahmen des Departements des Äusseren zu allen möglichen internationalen Problemen sind fragwürdig und unakzeptabel. Wir Schweizerinnen und Schweizer verpflichten unsere Regierung, Diplomatie und Verwaltung zum Stillesitzen, damit sie nicht in unserem Namen reden, wo sie schweigen sollten. Damit sie uns nicht in Konflikte hineinziehen, die dann die Bürger auslöffeln und mit ihrem Portemonnaie oder gar mit ihrem Leben bezahlen müssen.
Wir vernehmen heute unentwegt die Forderung nach einer «aktiven Neutralität». Der Begriff «aktive Neutralität» ist Ausfluss eines undisziplinierten Denkens, denn es handelt sich um einen Widerspruch in sich selber: Neutralität ist nämlich immer eine passive Haltung. Dennoch wird die bewährte schweizerische «Diplomatie des Vorbildes» zunehmend durch eine «Diplomatie des Zeigefingers» verdrängt. Die Ergebnisse dieser «Aktivierung» sind nicht vertrauensbildend: Wir hören heute eine zunehmende Politik der Phrasen, die einfach das wiederholt, was international gerade üblich ist. Es ist eine Politik des blossen Mitschwimmens im Chor der Unwahrhaftigkeit, der Heuchelei, der Sündenbockmentalität und der selbstgefälligen Unterscheidung zwischen «Guten» und «Bösen». Damit stossen wir andere Länder vor den Kopf, verärgern Handelspartner und schaffen sogar Feindschaften.
Neue Sinngebung für die Neutralität
In der jüngeren Vergangenheit wurde mit riesigem Optimismus versucht, diese Welt durch multinationale Organisationen und Institutionen zu organisieren. Die Neutralität erschien dabei vielen als überständiges Relikt und als isolationistische Fessel. Zwar konnte der nach dem Zweiten Weltkrieg etwas angezweifelte Leumund der schweizerischen Neutralität bei den Weltmächten durch die Leistung Guter Dienste vorerst wiederhergestellt werden. Im Zuge der europäischen Integration wird unsere Staatsmaxime allerdings aufs Neue infrage gestellt. Tatsächlich hat sich unsere Neutralität historisch angesichts der Spannungen zwischen unseren Nachbarn herausgebildet, und sie hatte sich vornehmlich gegenüber diesen Nachbarn zu bewähren. Wer die Neutralität lediglich als Mittel für den Kriegsfall zwischen unseren Nachbarstaaten beurteilt, muss an ihrem Sinn zweifeln, seit sich diese Kriegsmöglichkeit als äusserst unwahrscheinlich darstellt. Doch ist der schweizerischen Neutralität seit ihren Ursprüngen ein neuer Sinn zugewachsen. Die vielgenannte Globalisierung hat zu einer Schrumpfung der Welt geführt, sodass jeder Staat seine Politik nicht mehr nur im Verhältnis zu seinen Nachbarn, sondern zu allen Ländern dieser Welt bestimmen muss. Unsere grundsätzliche Friedenspolitik nebst weltweiter Handelspartnerschaft und Guten Diensten bietet dazu eine ausgezeichnete Grundlage. Wenn wir unserer Neutralität heute diesen weiteren, zeitgemässen Sinn geben, so wird sie noch lange gerechtfertigt bleiben.
Gerade die gegenwärtige massive Anfechtung dürfte nach meiner Einschätzung dem Neutralitätsgedanken letztlich zugute kommen – vielleicht mehr als die dogmatische, etwas lähmende Selbstverständlichkeit vergangener Jahrzehnte. Je mehr die führenden Kreise an der schweizerischen Neutralität kratzen, desto mehr wird sie hoffentlich zum Gegenstand von Volksdiskussionen im kleinen Kreis wie in Volksbewegungen, etwa im Schoss der «Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz». Damit belebt sich der schweizerische Neutralitätsgedanke wieder durch unseren Entschluss und unseren Willen.
Schon oftmals wurde unser kleines neutrales Land durch Machtansprüche von aussen bedrängt. Heute ist es weniger eine aggressive Macht, als eine überlaut und moralistisch vorgetragene Ideologie des Grossräumigen, die uns herausfordert. Wenn wir diesem Druck standzuhalten vermögen, wird unser Kleinstaat mit seiner Neutralität nicht zerstört werden, sondern von Neuem und gestärkt aufleuchten.